Der Pygmalioneffekt der Lehrergenerationen
Durch die Rekonstruktion der Wahrnehmungs- und Argumentationsmuster der Lehrer mehr als eines Jahrhunderts (1884-1993) ist die Bedeutung der langfristigen Schwankungen auf der Ebene der geistigen Strömungen ("Pygmalioneffekt der Lehrergenerationen") erkannt worden, die mit den Wellen des Bildungswachstums in spezifischer Art und Weise korrespondieren. Die Begabungsvorstellungen der Lehrer von Volks- und höheren Schulen lassen beispielsweise ein derartiges Schwingungsmuster deutlich erkennen.
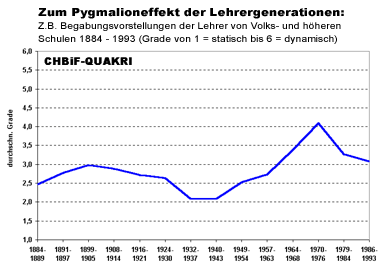
Mit Hilfe einer systematischen Inhaltsanalyse von 2.370 Artikeln der Lehrerverbandspresse
für den Zeitraum 1884 bis 1993 konnte festgestellt werden, dass Lehrer
an höheren Schulen und Volksschullehrer generationsspezifische Diskurse
zur Bildungsselektion führen. Mit den langen Wellen des Bildungswachstums
wandeln sich die pädagogischen Problemstellungen und damit mehrheitlich
die (Vor-)Einstellungen der Lehrergenerationen über die Schülerauslese
in spezifischer Art und Weise. Die Deutungsmuster der Generationen verändern
sich in der ständigen Auseinandersetzung mit der Umwelt in einem
ähnlichen Modus wie bei Einzelpersonen.
Als „Generation“ wird eine Alterskohorte, eine etwa gleichaltrige
Gruppe bezeichnet, die in einer bestimmten Zeit gemeinsame Erfahrungen
macht und gemeinsame Einstellungen entwickelt.
Als „Pygmalioneffekt“ werden individuelle Voreinstellungen
der Lehrer begriffen, die auf die Beurteilungen und entsprechende Selektion
bzw. auf Selbstbeurteilungen und Selbstselektion der SchülerInnen
übertragen werden.
Der in der Untersuchung festgestellte Effekt, die mit dem Wandel der Bildungsselektionsentwicklung
spezifisch wechselnden kollektiven Selektionslegitimationen, kann somit
als ein „historischer Pygmalioneffekt der Lehrergenerationen“
bezeichnet werden: Der konjunkturell bestimmte Legitimationswandel wird
aber von den Lehrern meist mit Hilfe anthropologischer Grundkonstanten
als entweder „realistische“ oder „hoffnungsvolle“
Eigenkonstruktion wahrgenommen. Ein derartiger Wandel von pädagogischen
Einstellungs- und Handlungsmustern muss als eine Bedingung von Fremdzuschreibungsmustern
für SchülerInnen angesehen werden, die wiederum zu Selbstattribuierungen
von Erfolg oder Misserfolg bei den Schülergenerationen führen.
Hier schließt sich der Kreis: Selbstzuschreibungen von SchülerInnen
sind entscheidende Leistungsbedingungen und damit Grundlagen für
die Selbstselektion. Kollektive Fremd- und Selbstselektionen aber führten
und führen zu den Bewegungen der Bildungsentscheidungen, der Selektionsentwicklung
im Schulsystem, welche wiederum das Selektionsklima und den Selektionswandel
beeinflussen.
Als eine typische Sequenz des Diskurswandels kann beispielsweise die Veränderung
der Selektionsbegründungen einer „Wachstumsgeneration“
gelten. Der Generationswechsel während des Höhepunkts einer
Wachstumswelle bringt eine Lehrergeneration in die Schulen, welche die
Öffnung der Bildungsselektion mit euphorischen Reformideen begleitet.
Am Ende der Wachstumswelle ist diese Lehrergeneration enttäuscht,
da die hochfliegenden Reformideen vom Beginn ihres Berufslebens nicht
mit den tatsächlichen Entwicklungen im Schulsystem übereinstimmen.
Diese Vermischung der Reflexionsebene mit der Leistungsebene des Bildungssystems
führt am Ende von Wachstumsphasen und zu Beginn von Stagnationsphasen
zu den typischen, kulturpessimistischen Einstellungsmustern.